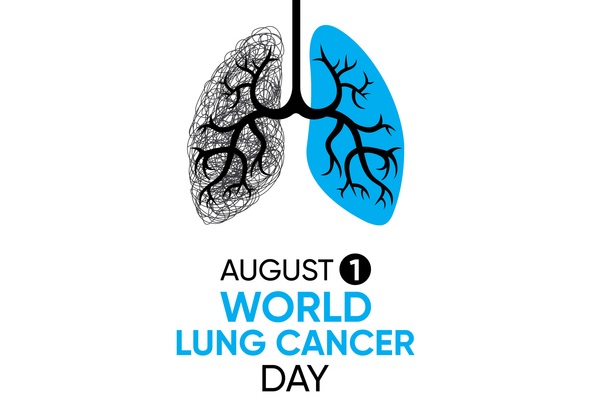Der Patient trägt grundsätzlich die Beweislast für das Vorliegen eines Behandlungsfehlers. Hierzu ist der Nachweis einer Abweichung der ärztlichen Behandlung vom fachmedizinischen Standard erforderlich. Der Beweis des Behandlungsfehlers ist nach § 286 ZPO zur Gewissheit des Richters zu führen. Geeignete Beweismittel sind die Behandlungsdokumentation sowie ein fachmedizinisches Gutachten durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen, der die gesamte Behandlungsdokumentation auswertet.
Bei der Erstellung seines Gutachtens wird der gerichtliche Sachverständige vor allem auf die Behandlungsdokumentation zurückgreifen. Daher hat eine ordnungsgemäße Dokumentation der Behandlung eine entscheidende Bedeutung im Arzthaftungsprozess, da diese Grundlage für eine Begutachtung durch einen gerichtlichen Sachverständigen zum Nachweis eines Behandlungsfehlers ist.
Die Dokumentationspflicht des Arztes
Die Dokumentationspflicht des Arztes ist in § 630f BGB gesetzlich normiert. Danach ist der Behandelnde verpflichtet, zum Zwecke der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. Dies ist auch für elektronisch geführte Patientenakten sicherzustellen.
Der Behandelnde ist dabei verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen.
Ziel und Zweck der Dokumentation
Ziel und Zweck der Dokumentation sind nicht die forensische Beweissicherung. Vielmehr sind Ziel und Zweck der Dokumentation die Gewährleistung sachgerechter medizinischer Behandlung durch den Erstarzt und weiterbehandeldnen Arzt. Denn die sichere Weiterbehandlung des Patienten ist zum großen Teil davon abhängig, dass Befunde gesichert und gewonnene Erkenntnisse festgehalten werden. Eine nicht hinreichende Dokumentation erschwert die Weiterbehandlung entscheidend und ist auch für den Patienten mit erheblichen Gefahren verbunden, wenn der Nachbehandler nicht vollständig informiert ist.
Umfang der Dokumentation
Inhalt und Umfang der Dokumentation sind zweckorientiert. Eine Dokumentation, die medizinisch nicht erforderlich ist, ist aus Rechtsgründen auch nicht geboten. Selbstverständlichkeiten sind nicht zu dokumentieren.
Dokumentationspflichtig sind Anamnese, Diagnose und Therapie und alle relevanten Informationen über den Therapieverlauf. Dies umfasst auch die erhobenen Befunde, die Krankenpflege, die angeordnete Medikation, Narkoseprotokoll, Operationsmethode, Operationsverlauf, die Person des Operateurs, den Wechsel des Operateurs, eingetretene Zwischenfälle, präoperativer Allgemeinzustand, getroffene Vorkehrungen gegen Selbstverletzungen des Patienten, jede Abweichung von Standardmethoden und Standardvorgängen.
Ausnahmsweise kann aus medizinischer Sicht auch die Pflicht bestehen, negative Befunde zu dokumentieren, etwa wenn Anlass zur Ausräumung eines Verdachts besteht oder bei medizinisch besonders wichtigen Befunden.
Der Arzt muss aber nicht nur Befunde dokumentieren, sondern auch erhobene Befunde sichern. Dementsprechend gehört es zu den Organisationsaufgaben der Behandlungsseite (Arzt, Krankenhausträger) sicherzustellen, dass Unterlagen, die Auskunft über das Behandlungsgeschehen geben, jederzeit aufgefunden werden können. Es dürfte auch dann eine Verletzung der Befundsicherungspflicht vorliegen, wenn die Dokumentation zwar durchgeführt worden ist, aber das verwendete Medium (z.B. bei Verwendung eines Thermodruckers) nicht ausreichend haltbar und deshalb die Dokumentation nicht mehr lesbar ist. Der niedergelassene Arzt und auch das Krankenhaus müssen die Behandlungsunterlagen gemäß § 630f Abs. 3 BGB 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufbewahren.
Folgen von Dokumentationsmängeln
Eine Verletzung der Dokumentationspflicht hat keine eigenständige Anspruchsgrundlage zur Folge und führt nicht unmittelbar zu einem Schadensersatzanspruch.
Nach § 630h Abs. 3 BGB kommen dem Patienten Beweiserleichterungen aus pflichtwidrig unvollständiger oder widersprüchlicher Dokumentation zugute, wenn sich hieraus eine Verschlechterung der Beweissituation hinsichtlich des Nachweises eines Behandlungsfehlers für den Patienten ergibt. Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.
Die ärztliche Dokumentation indiziert in der Regel, dass darin genannte Behandlungsmaßnahmen durchgeführt wurden bzw. unterblieben sind, wenn entsprechend dokumentationspflichtige Tatsachen nicht erwähnt werden. Lässt die Behandlungsseite pflichtwidrig dokumentationsbedürftige Befunde in den Krankenunterlagen undokumentiert oder findet eine Therapieaufklärung, die zu dokumentieren wäre, pflichtwidrig in den Krankenunterlagen keinen Niederschlag, folgt hieraus ein Indiz dafür, dass, was nicht dokumentiert, auch nicht geschehen ist.
Insoweit ist seitens des Gerichts zunächst zu klären, insbesondere unter Berücksichtigung des Parteivortrages und der Ausführungen des gerichtlich bestellten Sachverständigen, was im Einzelnen hätte geschehen müssen. Ist dazu nichts ausreichend dokumentiert, wird vermutet, dass die aus medizinischer Sicht erforderlichen Maßnahmen unterblieben sind. Sodann muss das Gericht die Unterlassung der erforderlichen Maßnahmen haftungsrechtlich würdigen.
Dem Patienten obliegt allerdings trotzdem noch der Nachweis darüber, dass die Gesundheitsschädigung nicht eingetreten wäre, wenn die nicht dokumentierte Behandlung ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre.
Widerlegbare Vermutung
Grundsätzlich steht es der Behandlerseite offen, die für den Patienten günstige Vermutung, dass das, was nicht dokumentiert, auch nicht geschehen ist, zu widerlegen. Hierzu steht es der Behandlerseite frei, einen entsprechenden Gegenbeweis zu führen. Die Behandlerseite muss dann zur Überzeugung des Gerichts beweisen, dass entgegen der Dokumentation der Befund erhoben, die Maßnahme vorgenommen oder die Therapieaufklärung erteilt worden ist. Hierzu kann die Behandlerseite beispielsweise entsprechenden Zeugenbeweis anbieten. Wenn der Behandlerseite der Gegenbeweis gelingen sollte, bleibt die mangelhafte Dokumentation insoweit beweisrechtlich unschädlich.
Fazit
Dokumentationsmängel können für den Patienten sehr günstige Auswirkungen in der Beweislastverteilung haben. Auch durch Dokumentationspflichtverletzungen kann eine Beweislasterleichterung zugunsten des Patienten eingeräumt werden. Eine nicht dokumentierte (dokumentationspflichtige) Maßnahme wird deshalb als nicht durchgeführt erachtet. Die Dokumentation liegt allein im Einflussbereich des Arztes. Fehler hieraus können dem Patienten nicht angelastet werden. Haftungsrechtlich ist daher von einer Unterlassung der erforderlichen Maßnahme auszugehen.
Als Fachanwälte für Medizinrecht begleiten wir Sie auf dem Weg, ein angemessenes Schmerzensgeld und Schadensersatz zu erhalten. Uns ist es ein Anliegen, dass Sie eine gerechte Entschädigung erhalten. Der wichtigste Baustein ist dabei der Nachweis eines Behandlungsfehlers, der zu einem Schaden geführt hat. Patienten obliegt grundsätzlich die Beweislast hierfür, sodass Beweiserleichterungen oder sogar eine Beweislastumkehr im Arzthaftungsverfahren von großer Bedeutung sind. Daher ist es wichtig, sich kompetente Unterstützung durch Spezialisten im Medizinrecht zu suchen, um zum Erfolg zu gelangen.
Ein Beitrag von Anna Hannen.

 Zum Inhalt springen
Zum Inhalt springen